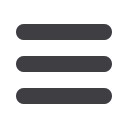
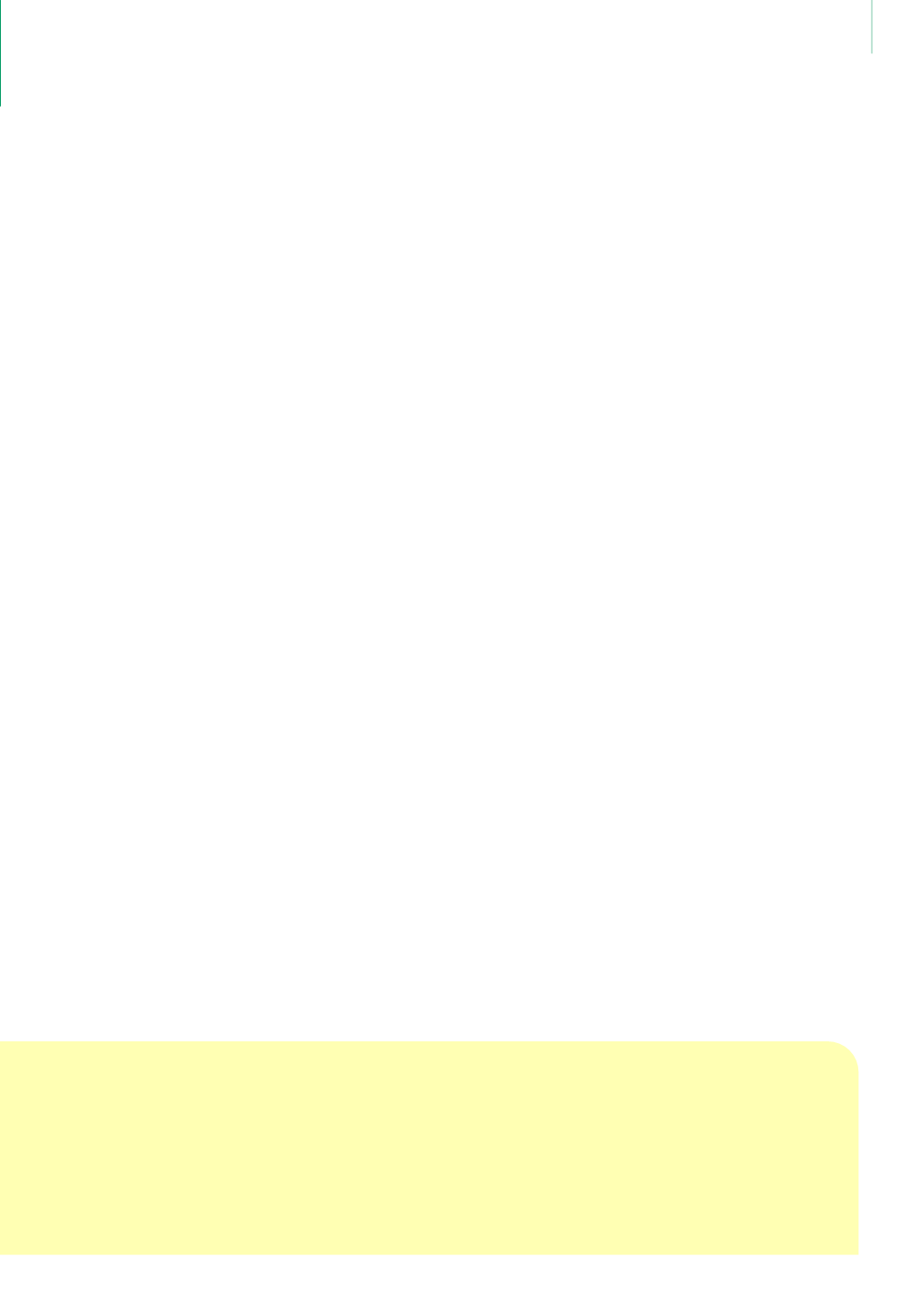
fussballtraining 6+7/2014
Interview
3
gemeinsam handeln. Dies gilt vor allem für die Defensive, wo jeder
wissen muss, wie sich der Mitspieler in der jeweiligen Situation
verhält. In der Offensive hingegen gibt es viele Handlungsalterna-
tiven – hier muss Raum für Kreativität bleiben. Dennoch können
auch dort gemeinsame Prinzipien das Zusammenspiel optimieren.
Und das Spielkonzept?
Im selben Zusammenhang kann auch dieser Begriff gesehen wer-
den – nicht umsonst wird ja auch gern vom ‘Konzepttrainer’
gesprochen. Das betraf in der Vergangenheit vor allem die Trainer,
die aus der Jugendarbeit kamen bzw. einen sportwissenschaftli-
chen Hintergrund hatten. Ich bin aber sicher, dass jeder Trainer ein
Konzept hat, dass jeder eine bestimmte Spielidee verfolgt. Ich
glaube, dass auch in den Amateurligen kein Trainer mehr zum Trai-
ning oder Spiel kommt und sagt: „Mal sehn, was heute so geht!“
Was ist denn dabei wichtigste Eigenschaft des Trainers?
Seine Qualität liegt vor allem darin, dass er die Spieler von seinen
Ideen überzeugt und mitnimmt, dass er sie systematisch, kontinu-
ierlich und konsequent vermittelt. Dazu kann viel Überzeugungs-
arbeit notwendig sein und letztlich sind immer die aktuellen Gege-
benheiten, Voraussetzungen und Umstände zu berücksichtigen.
Wie entsteht eine Spielidee?
Jeder Trainer hat sicher eine Idealvorstellung: Wie würdest du am
liebsten Fußball spielen lassen, wenn die Bedingungen so sind,
wie du sie mit den Spielern deiner Wahl stellen könntest? Hier hat
übrigens Frank Wormuth bei der Fußballlehrer-Ausbildung etwas
sehr Gutes eingeführt: Ein eigenes Trainer-Buch. Darin beschreibt
jeder angehende Fußballlehrer, wie er sich ‘seinen’ idealtypischen
Fußball, seine Arbeitsweise, seine Teamführung und sein Umfeld
vorstellt. Diese Vision bildet die Basis, von der aus er sich immer
wieder an die Aufgabenstellung und die Möglichkeiten anpassen
und entscheiden muss, welche Kompromisse er eingehen kann.
Welche Kompromisse können das sein?
Da gibt es sehr viele und vielfältige. Sicher kommen wir im Lauf
des Gesprächs noch auf einige zu sprechen. Pläne sind ja dazu da,
verändert zu werden – oder zumindest die Möglichkeit zur Verän-
derung zu bieten. Doch ohne einen Plan geht gar nichts. Ich muss
eine Idee haben, aber auch wissen, dass ich sie so idealtypisch
eigentlich nie umsetzen kann. Ich muss also bereit sein, hier und
da von ihr abzuweichen, ohne sie gänzlich zu vergessen. Keinen
Sinn macht es, eine Aufgabe zu übernehmen, deren Merkmale
konträr zu deinen Überzeugungen sind. Kompromisse sind not-
wendig, dürfen aber nicht dazu führen, deine Linie zu verlassen.
Können Sie dazu aus eigener Erfahrung etwas sagen?
Nicht im negativen Sinne. Aber ich habe beim SC Paderborn und
beim FC St. Pauli recht unterschiedliche Bedingungen gehabt und
dennoch an den Prinzipien meiner Spielidee festgehalten. Natür-
lich habe auch ich meine Vorstellungen vom Spiel. Und die versu-
che ich einzubringen und umzusetzen – aber eben unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Umstände. Wir sind 2009 mit Paderborn
in die Zweite Bundesliga aufgestiegen, nachdem ich die Mann-
schaft erst kurz vor Saisonende übernommen hatte. Es war klar,
dass wir keine teuren Neuzugänge würden verpflichten können,
obwohl wir zu den Abstiegskandidaten gezählt wurden. Doch die
Mannschaft war technisch gut ausgebildet, trat in Angriff wie Ab-
wehr sehr strukturiert auf und konnte unglaublich gut auf Angriff
umschalten. Das zeichnet das Team und den Verein noch immer
aus. Die Spieler, die zuletzt hinzugekommen sind, können all das
richtig gut. Und Andre Breitenreiters Ideen sowie die Neuverpflich-
tungen passen, die Mannschaft hat sich klar weiterentwickelt.
Oder St.Pauli: 2011 aus der 1.Liga abgestiegen, wurden wir sofort
zu den Topfavoriten gezählt. Wir mussten uns darauf einstellen,
dass uns unsere Gegner mehr Ballbesitz überlassen würden als
mein Co-Trainer Jan-Moritz Lichte und ich es aus Paderborn kann-
ten. Wir mussten uns also neue Gedanken machen, wie wir das
Spiel eröffnen, wir es aufbauen und wie wir den Ball vor das geg-
nerische Tor befördern möchten.
Damit sind wir wieder bei den Prinzipien einer Spielidee…
Sie ist für mich durch folgende Fragen und die entsprechenden
Antworten zum eigenen und gegnerischen Ballbesitz und den
daraus entstehenden vier Grundsituationen geprägt:
Wie verhalten wir uns bei Ballgewinn und unorganisiertem Geg-
ner? Und wie bei Ballgewinn und organisiertem Gegner?
Wie verhalten wir uns bei Ballverlust? Ist eine sofortige Balljagd
möglich? Oder haben wir keine Chance, Druck auf den Ballbesit-
zer auszuüben?
Aus diesen Fragen kann man nun seine eigene Spielidee Stück für
Stück immer weiter herunterbrechen und präzisieren – verbunden
mit den Fragen, welche technischen, konditionellen und psychi-
vielen Faktoren abhängig
regung befindliche Umfeld. In dieser Problemlage Kreativität,
Spiel- und Lauffreude, gleichzeitig aber auch Selbstvertrauen und
unbändigen Kampfeswillen bei einer Mannschaft zu wecken, stellt
eine große Herausforderung dar.
Die mittel- und langfristige Entwicklung einer Mannschaft unter
Berücksichtigung der eigenen Spielidee bzw. Spielphilosophie ist
nicht weniger schwierig. Idealerweise sollten sich die Spielphilo-
sophie und Ziele des Trainers mit der des Vereins decken. Oft
genug ist eine besondere Clubphilosophie aber leider nicht zu
erkennen. Und so kommt es verbunden mit einem Trainer-
wechsel auch häufig zu einem Richtungswechsel und einer
entsprechenden Spielerfluktuation. Decken sich die Vorstel-
lungen des Clubs und des Trainers, fällt diese geringer aus, die
weitere Entwicklung ist dann etwas leichter.
















